Matthias Morgenstern, Monika Garruchet (Hg.). Mit Fotos von Ewald Freiburger, J. S. Klotz Verlag, Neulingen 2023. 264 Seiten. Hardcover 27,90 €. ISBN 978-3-949763-53-3
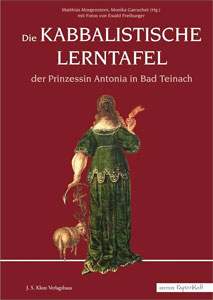
Der Sammelband, der anlässlich des 350. Jahrestags der Aufstellung des Triptychons der Prinzessin Antonia von Württemberg (1613–1679) in Bad Teinach erschienen ist, nennt dieses eine »kabbalistische Lerntafel« entgegen der sonst gebräuchlichen Formulierung einer »Lehrtafel«. Das ist ungewöhnlich, wird aber gleich zu Beginn thesenhaft begründet: »Der farbenprächtige Schrein präsentiert weder fertige Lehren noch ›von oben herab verkündete‹ Glaubenswahrheiten im Sinne eines Katechismus. Er lädt seine Betrachterinnen und Betrachter vielmehr dazu ein, sich auf einen Weg des Lernens [Hervorhebung im Original] zu machen – den Weg, das Geheimnis zu erkunden, das die Bad Teinacher Kirche in ihrem Namen trägt, die Dreieinigkeit des lebendigen Gottes.« (S. 9)
In seinen drei Hauptaufsätzen zeigt der Band nun, wie sich diese These begründen lässt.
Der erste und bei weitem umfangreichste Beitrag von Matthias Morgenstern, Professor für Religionswissenschaft und Judaistik am Institutum Judaicum der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, zeigt das theologische Programm und seine kunsthistorische Umsetzung der »Lerntafel« auf »Die kabbalistische Lerntafel der Prinzessin Antonia in Bad Teinach«, S. 8–127). Dazu klopft er ausführlich den geistesgeschichtlichen Hintergrund ab, von der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rezeption der jüdischen heiligen Texte, über Antonias Biografie und den Kontext im Dreißigjährigen Krieg, weiter über das große Feld der jüdischen Mystik bis hin zum Gelehrtennetzwerk um die Prinzessin mit Persönlichkeiten wie Johann Valentin Andreae, Johann Lorenz Schmidlin, Johann Jakob Strölin und anderen. Das geschieht auf kluge und kenntnisreiche Weise, die »Lerntafel« erschließt sich in ihrer Komplexität und mit ihren Kontextualisierungen. Etwas nachgeschoben wirkt das fünfte und letzte Kapitel »Die Kabbala im deutschen Protestantismus«, da einzelnes bereits zuvor angesprochen wurde.
Die evangelische Pfarrerin und Studienleiterin an der theologischen Fakultät der Universität Bern, Monika Garruchet, verbindet in ihrem Beitrag »Notizen zur Biografie der Lerntafel und ihrer Autorin – eine Spurensuche« (S. 128–171) die biografische Darstellung des Lebens der Prinzessin Antonia und die Entstehung der »Lerntafel«, in dessen Konzeption sie »ihr ganzes Herzblut« legte und »in dem alle Wissens- und Glaubensstränge ineinanderliefen, die ihr wichtig waren« (S. 146). Antonia war zwar keine Allein- Autorin, sondern genuine Initiatorin und quasi inhaltliche Architektin der »Lerntafel«; es ist, so die Quintessenz bei Garruchet, ihr Vermächtnis, ihr Erbe, der künstlerische Ausdruck ihrer glaubenden und hoffenden Persönlichkeit. Dazu passt, dass ihrem Wunsch entsprechend nach ihrem Tod ihr Herz bei der »Lerntafel« begraben wurde und es somit auch als Epitaph gesehen werden kann.
Der dritte Beitrag: »Zwei hebräische Gebete der Prinzessin Antonia von Württemberg (1613–1679) im Kontext der Einweihung der kabbalistischen Lerntafel in Bad Teinach« von dem Kirchenhistoriker und wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Reinhard Gruhl, und dem schon genannten Matthias Morgenstern, (S. 172–201) stellt diese heute in der Württembergischen Landesbibliothek (Cod. or. qt. 2) verwahrten Gebete vor, die nicht nur ihre Frömmigkeit, sondern auch ihre Hebräisch-Kenntnisse dokumentieren. Nach einleitenden Abschnitten werden die Gebete als Reproduktion der Handschrift sowie in ihrer deutschen Übersetzung dargeboten und kommentiert.
Der Anhang zu diesen beiden Aufsätzen besteht seinerseits wiederum aus einigen einzelnen Beiträgen, die ohne allzu direkte Bezüge Hintergründe aus dem Leben der Prinzessin Antonia beleuchten. So widmen sich Monika Garruchet und Matthias Morgenstern in Anhang I »Der Kanzeldeckel in der Jakobuskirche Brackenheim« (S. 202–211) einem weiteren »Kleinod christlicher Kabbala in Württemberg« (S. 203), dessen theologische Bezüge aufgezeigt werden. Anhang II stellt mit Beiträgen von Monika Garruchet, dem Dekan an der Evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt, Eckart Schultz-Berg, und dem Mitbegründer und Mitgesellschafter des J. S. Klotz Verlagshauses Ewald Freiburger die Stiftungen der Prinzessin Antonia in Brackenheim, Bad Cannstatt, Herrenberg, Neubulach, Schorndorf und Weiler zum Stein vor (»›Mein geringes scherblin auch dem Herrn zue brüngen …‹ – Die Stiftungen der Prinzessin Antonia von Württemberg«, S. 213–237). Der Band wird beschlossen von einem ausführlichen Glossar mit Fachbegriffen sowie einem Personenregister.
Der materialreiche Band ist mehr als eine Zusammenführung der bisherigen Forschung zum Teinacher Triptychon der Prinzessin Antonia: Vor allem durch die Akzentverschiebung von der »Lehrtafel« zur »Lerntafel« werden neue Bedeutungsdimensionen erschlossen, die dieses im besten Sinne eigenwillige und höchst interessante Kunstwerk an der Schnittstelle von theologischer Gelehrtheit und höfischer Adelskultur weiter erhellen.
Carsten Kottmann
Views: 7
