Der Ulmer Rat im Konflikt mit geistlichen Einrichtungen (1376–1531)
Schriften zur Südwestdeutschen Landeskunde 84. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2023. 580 Seiten. Hardcover 64,00 €. ISBN 978-3-7995-5284-4
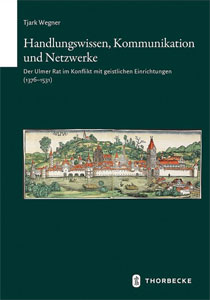
Ulm entwickelte sich im Spätmittelalter zur führenden Macht unter den südwestdeutschen Reichsstädten. Jedoch bewahrten die wirtschaftliche und politische Bedeutung die Stadt nicht vor inneren Konflikten. Einer davon hatte seine Ursache im Versuch des Rates, des zentralen Herrschaftsgremiums, die geistlichen Institutionen der Stadt unter seine Kontrolle zu bringen und im Widerstand Letzterer dagegen. Die so verursachten Konflikte sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die als Dissertation bei Frau Professor Sigrid Hirbodian am Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen entstanden ist. In ihrem Zentrum steht die Frage, auf welche Weise der Ulmer Rat das Wissen erlangte, welches er für Maßnahmen gegen geistliche Einrichtungen (Auswahl: Wengenstift, Dominikanerkloster, Franziskanerkloster, Klarissenkloster Söflingen und Sammlung an der Frauenstraße) benötigte, und wie die geistlichen Einrichtungen ihrerseits Zugang zu den für den Widerstand notwendigen Informationen bekamen. Der Untersuchungszeitraum reicht von 1376, dem Jahr der Verlegung der Pfarrkirche in die Stadt, und endet mit der Einführung der Reformation 1531.
Zur Analyse werden aus der modernen Soziologie und Psychologie abgeleitete Konzepte verwendet: Netzwerke, Kommunikation und Handlungswissen. Wobei Handlungswissen »beschreibt, was jemand wissen muss, um eine Aufgabe zu lösen und sich in einer Situation kompetent zu verhalten«. Ungeachtet des Titels spielen aktuelle Netzwerk- und Kommunikationstheorien jedoch laut Autor in der Arbeit »eine untergeordnete Rolle«. Ist doch ihr Ursprung zeitbezogen. Vielmehr wird der »Fokus« auf die »historisch-kritische Methode« gelegt und die Arbeit »in die empirische Tradition der landesgeschichtlichen Forschung« gestellt. Mit anderen Worten, der Analyseansatz wird (zu Recht) dem Untersuchungsgegenstand angepasst.
Untersucht werden folgende Akteure bzw. Akteursgruppen: Ulmer Bürgerschaft, Adel (Landadel, württembergische Grafen und Herzöge, bayerische Herzöge) sowie der Rat und die Konvente. Letztere waren dabei auf vielfältige Weise miteinander vernetzt. Es bestanden z.B. Verbindungen der im Rat vertretenen Familien zu geistlichen Einrichtungen (über Stiftungen, Grablegen, Familienmitglieder) und gleichzeitig partizipierten diese Familien an der städtischen Obrigkeit.
Als Beispiel für die Analyse im Hauptteil seien hier die Bemühungen des Rates erwähnt, ab 1465 die Klarissen, Franziskaner und das Wengenstift zu reformieren. Zunächst generierte der Rat Handlungswissen, indem er seine Netzwerke nutzte und sich zur Informationsbeschaffung an andere Städte wandte. Darunter war Speyer, das zuvor das dortige Franziskanerkloster erfolgreich reformiert hatte. Nach dieser Phase begannen konkrete Reformvorbereitungen. Der Rat ließ über Herzog Ludwig IX. von Bayern-Landshut ein Schreiben an den Papst schicken, in dem jener im Namen der Ulmer den Empfänger bat, die städtischen »Klöster wieder zu einem regelkonformen Leben zu führen«. Da dies offenbar ohne Erfolg blieb, nahm der Rat Kontakt zu Cristoforo Moro, dem Dogen von Venedig, auf, der über gute Beziehungen zur Kurie verfügte, um sein Reformansinnen abermals vor den Papst zu bringen. Die Gegenseite reagierte darauf und so nahm z.B. das Klarissenkloster seinerseits Kontakte zur Beschaffung von Handlungswissen auf. Es konnte dabei auf »ordensinterne Netzwerke« zurückgreifen. Ein unbekannter Franziskaner gab ihnen dabei Hinweise, wie eine Reform verhindert werden könnte. Die Nonnen erhielten dadurch Informationen, die »einen hohen Wissensgrad über juristische und ordensinterne Vorgänge« aufwiesen.
Eine Zusammenstellung der mit der Ulmer Kloster- und Kirchenpolitik in Zusammenhang stehenden Familien, von Listen mit Konventsmitgliedern, eine Ratsliste sowie ein Personen- und ein Ortsregister runden den Band ab.
Die vorliegende Arbeit zeigt die große Bedeutung von Informationen in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ulmer Kirchenpolitik und die Rolle netzwerkartig strukturierter persönlicher Beziehungen zu deren Beschaffung. Damit liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Netzwerkstrukturen, die in vormoderner Zeit die Durchsetzung von Politik überhaupt erst ermöglichten.
Ergänzend ist noch anzumerken, dass das Vorgehen des Ulmer Rats gegen die geistlichen Einrichtungen als Teil der allgemeinen Tendenz zur Verdichtung von Herrschaft zu betrachten ist. Doch diese Anmerkung schmälert auf keine Weise den Eindruck einer sorgfältig erarbeiteten und innovativen Arbeit von hohem Wert.
Christoph Florian
Views: 111
