Claudius Verlag, München 2023. 181 Seiten. Hardcover 20 €. ISBN 978-3-532-62885-0
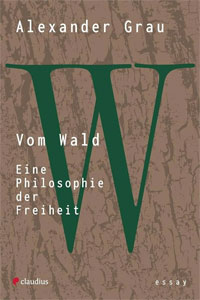
Bücher über Wald gibt es viele, von Förstern, Biologen und Naturfreunden geschrieben. Von einem Philosophen erwartet man nicht unbedingt ein Buch über Wald. Man muss deshalb dem Untertitel des Buches Bedeutung zumessen und in der Tat: Dem Autor geht es um den weitgefassten Begriff der Freiheit, die der Mensch, so seine Erkenntnis, am besten im Wald finden und ausleben kann. Diese Funktionszuweisung hat durchaus mit Natur und Landschaft zu tun und so ist eine Besprechung des außergewöhnlichen Buches hier auch gerechtfertigt.
Man tut gut daran, zunächst die Begriffe »Kontingenzerfahrung« und »Ambivalenzerleben« zu googeln, denn diese ziehen sich durch das ganze Buch. Für nicht philosophisch Gebildete ist das Begriffspaar vielleicht am ehesten mit einem alten Schlagertitel zu umschreiben: »Ob es so oder so oder anders kommt; so wie es kommt, so ist es recht.« Was hat das mit Wald zu tun? Grau hat die Erkenntnis gewonnen, dass ein Waldspaziergang Distanz zum oft stressigen Alltag in der Stadt schafft und den Kopf freimacht. Für Naturfreunde ist das nichts Neues, Erlebnisse während eines Waldspaziergangs kann man allerdings auch ohne Fremdworte schildern. Aber der Autor geht tiefer und untersucht, wie das Walderleben auf uns Menschen wirkt und wie man es schafft, sich im Wald von mancherlei unliebsamen Zeitströmungen abzuschotten. Meer und Gebirge können ähnliche Wirkungen haben, Wald aber ist für ihn – Naturfreunde und Kenner der Forstwirtschaft sehen das vielleicht etwas anders – das Gegenteil von Kultur, von Ordnung, von Zwang – Freiheit eben, die uns in unserem täglichen Leben daheim oder im Büro abgeht. Das Sprichwort »Stadtluft macht frei!« bezieht sich übrigens auf die mittelalterliche Leibeigenschaft; Grau stellt richtig, dass die in die Städte wandernden Menschen statt der Abhängigkeit von Landesherren und Grundbesitzern in die Abhängigkeit von Unternehmern und Fabrikanten schlitterten und sich neuen Formen der Unterwerfung und des Elends ausgesetzt sahen. Ob da Waldspaziergänge hilfreich gewesen wären, untersuchte er allerdings nicht. Die Wandervogelbewegung und die Gründung der Heimat- und Wandervereine haben allerdings sehr wohl mit den gesellschaftlichen Entwicklungen am Übergang zum Industriezeitalter zu tun.
Der Autor bemüht eingehend eine Reihe von Literaten und Künstlern und deren Äußerungen zum Thema Wald. Das beginnt bei den Gebrüdern Grimm (Hänsel und Gretel), geht über Heinrich Heine (Harzreise) und Adalbert Stifter bis zu Jean-Paul Sartre. Die meisten haben den Wald in irgendeiner Weise als Sehnsuchtsort geschildert, einige auch als Bedrohung – alle aber als Kontrast zu Kultur und menschlicher Lebenswelt. Am deutlichsten wird der Gegensatz Kultur – Natur wohl bei Caspar David Friedrichs Gemälde »Klosterruine Eldena«, das die Vergänglichkeit von Menschenwerk und die Allmacht des alles überwuchernden Waldes drastisch zeigt. Eines Mannes wird auch gedacht (S. 132), allerdings eher nebenbei: Ernst Rudorff, Komponist, Umweltschützer und (Mit-)Begründer des Deutschen Bundes Heimatschutz 1904. Sein Bestreben war es, Landschaften in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren. Flurbereinigungsmaßnahmen mit zwanghaften Veränderungen von Bächen, Waldrändern und Nutzungsgrenzen in der Landschaft, mit Ersatz von Ursprünglichkeit durch rechte Winkel und Geraden waren ihm verhasst; er übte allerdings insgesamt Kritik an moderner Zivilisation. Also auch hier die Sehnsucht nach Freiheit statt starrer Landschaftsregulierung und gesellschaftlicher Normierungen.
Man findet in Graus Ausführungen zahlreiche Widersprüche, bemerkt aber bald, dass diese als dialektisches Ausdrucksmittel auf das Schlusskapitel hinzielen. Widersprüchlich sind zum Beispiel die Antworten auf seine Fragestellung, ob das Leben in der Stadt oder in der Waldeseinsamkeit in Bezug auf freie Lebensentscheidungen mehr böse Überraschungen mit sich bringen könne (S. 11– 13). Er hält die Gefahren im Wald für größer, da man sich beispielsweise verirren kann, das kann man aber in einer Stadt ebenfalls und einen Unfall kann man in der Stadt wie im Wald haben. Das alles klärt sich dann erst in den Schlusssätzen (S. 172): »Der Wald steht für das Überraschende, Unüberschaubare und Unberechenbare, das sich dem Zugriff menschlicher Unterwerfungsutopien widersetzt. Der Wald ist ein Refugium der Freiheit.« Das ist das Fazit des Buchs.
Wer das alles versteht und bereit ist, Ausdrücke wie »Inkompetenzkompensationskompetenz« (S. 51) zu akzeptieren, der kann für sich selber und für seinen Lebensstil in dem Buch tatsächlich Interessantes über die Rolle des Waldes in Bezug auf unser Dasein nachlesen und sich in seinem Inneren mit existenziellen Fragen der Freiheit und gesellschaftlicher Zwänge beschäftigen. – Ein Waldspaziergang dürfte allerdings denselben Effekt haben.
Reinhard Wolf
Views: 22
