[vollständiger Titel:] Gerhard Fritz: Wasserkraftnutzung im Mittelalter in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. Mühlen, Sägen, Hammerwerke und andere wassergetriebene Anlagen
(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 216). Thorbecke Verlag, Ostfildern 2024. 1013 Seiten, zahlr. Abb., CD-ROM; Hardcover 88 €. ISBN 978-3-7995-9581-0
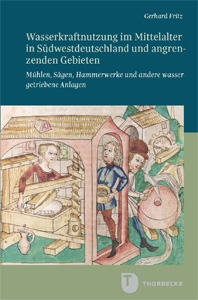
Mit der vorliegenden Untersuchung zur Wasserkraftnutzung im mittelalterlichen Südwestdeutschland hat Gerhard Fritz, von 2002 bis 2020 Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Hochschule Schwäbisch Gmünd, nicht nur ein im Wortsinn gewichtiges und voluminöses Werk veröffentlicht, sondern auch die Quintessenz seiner langjährigen Beschäftigung mit diesem Thema. In die monumentale Bestandsaufnahme flossen die Erkenntnisse aus früheren Forschungen ein, wie beispielsweise die Arbeiten an dem von ihm herausgegebenen Mühlenatlas Baden-Württemberg, einem seit den 1990er-Jahren laufenden Unternehmen.
In der Einleitung weist Fritz darauf hin, dass die Wasserkraftnutzung, insbesondere in der vorindustriellen Zeit, untrennbar mit dem Begriff der Mühle verbunden war, Mühle im Sinne des Mittelalters übersetzt als »wassergetriebene Anlage«. Doch geht es in seinem Buch nicht allein um die Geschichte der Getreidemühlen, sondern um alle Anlagen, in denen Wasserkraft als Antrieb und Energiequelle eine Rolle spielte. Eingeschlossen sind demnach nicht nur die zum Mahlen von Agrarprodukten (Getreide, Saaten) betriebenen Mühlen, sondern auch die zu handwerklich-gewerblichen Zwecken entwickelten Wasserkraftanlagen (Lohmühle, Walkmühle, Sägemühle, Schleifmühle, Eisenhammer, Waffenschmiede, Papiermühle, Pulvermühle usw.). Der Blick auf die unterschiedlichen Anlagen lässt erkennen, dass Mühlenforschung über Agrar-, Wirtschafts- und Technikgeschichte hinausgeht und zu einer Spezialdisziplin geworden ist, die sich unter der Bezeichnung »Molinologie« etabliert hat und international verbreitet ist. Dank ihrer Ergebnisse kann die Forschung zu wassergetriebenen Anlagen auch zu allgemeinhistorischen Fragestellungen aus dem Bereich der mittelalterlichen Geschichte Antworten beisteuern. Als Beispiel dafür nennt Fritz u.a. die Entwicklung des Lehenswesens, da viele Mühlen Lehenbesitz waren und die meisten Mühlen als Erblehen ausgegeben wurden.
Seine Untersuchung beruht, wie Fritz darlegt, »auf der systematischen Auswertung der publizierten Quellen des deutschen Südwestens«. Diese werden ebenso wie die ungedruckten Quellen und die Sekundärliteratur in einem mit über 80 Seiten außerordentlich umfangreichen Verzeichnis aufgeführt.
Da allein schon der Text mit seinen annähernd eintausend Seiten den Platz zwischen zwei Buchdeckeln zu sprengen drohte, sahen sich Autor und Kommission wohl gezwungen, gewichtige Teile der Arbeit auf einer im hinteren Buchdeckel beigefügten CD-ROM unterzubringen. Auf dieser finden sich, wie das Inhaltsverzeichnis ausweist, Anhänge und Register, wobei die Anhänge aus 21 Dateien mit weiteren 540 Seiten bestehen. Hingegen wurden die 21 Tabellen wie auch die 17 Abbildungen in den Haupttext integriert. Dass die Auslagerung des Datenmaterials auf eine CD aus praktischen Gründen notwendig war, ist nachvollziehbar; der erschwerte Zugang zu den Registern ist allerdings bedauerlich, beispielsweise für einen Benutzer, der gerne spontan nach einem bestimmten Ort gesucht hätte. Als besondere Hürde kommt hinzu, dass moderne PCs meist nicht (mehr) über ein CD-Laufwerk verfügen (was auch für den Laptop des Rezensenten gilt).
Schauen wir auf die Gliederung des Buches, dann setzt Fritz nach einführenden Bemerkungen zur Quellenlage und zum Forschungsstand ein mit archäologischen Befunden und schriftlichen Überlieferungen zu den Mühlen im Früh- und Hochmittelalter, um sich dann dem Personal der Mühlen, also den Eigentümern, Betreibern (Müllern) und Knechten zuzuwenden. Im folgenden Kapitel geht es um Relationen, nämlich zwischen der Zahl der Mühlen und der Zahl der zu versorgenden Menschen sowie um den Bau neuer Mühlen, der sich wellenförmig vollzog. Ein eigenes Kapitel ist den rechtlichen Fragen vorbehalten; die Stichwörter sind hier Baurecht, Mühlfrieden, Mühlenordnung und Mühlenbann. Wieviel war eine Mühle wert? Um den Wert bestimmen zu können, kommen zwei Indikatoren in Betracht: zum einen der Kaufpreis, der sich über die Jahrhunderte wandelte, zum anderen die Wertschöpfung, also im Wesentlichen der Ertrag aus Abgaben und Leistungen, wobei im Mittelalter zwischen Bargeld- und Naturalabgaben zu unterscheiden ist.
In einem weiteren langen Kapitel schildert Fritz die Wirtschaftsweise und den Arbeitsalltag der Mühlbetriebe; abgesehen von Alltagsproblemen rings um die Abgaben geht es um praktische Vorgänge wie das Mahlen, Messen und Wiegen, um die Nebentätigkeiten der Müller und um konkurrierende Interessen bei der Wasserkraftnutzung. Ein weiterer Themenkomplex sind die geographisch-topographische Lage, der Bautyp und die Ausstattung der Mühlen, womit namentlich das äußere und innere Mühlgeschirr gemeint sind. In den Bereich der Technik weist die Frage nach der Kraftübertragung, die je nach Mühlentyp unterschiedlich war. Spielten bis hierhin vor allem Getreidemühlen eine zentrale Rolle, so werden im letzten Kapitel die Spezialmühlen behandelt: Mühlen in der Metallgewinnung, Walkmühlen, Sägmühlen und weitere Typen. Am Schluss des Buches folgt eine weitere 66 Seiten lange inhaltliche Zusammenfassung der vorausgehenden zehn Kapitel.
Mit seinem monumentalen Werk ist es dem Autor gelungen, höchst unterschiedliche Aspekte der Wasserkraftnutzung in Südwestdeutschland im Mittelalter zu thematisieren. Wenn er schreibt, dass es von vorneherein nicht möglich gewesen sei, Vollständigkeit zu erreichen, dann bezieht sich das offenbar darauf, dass die Quellenbasis im Verlauf des jahrelangen Arbeitsprozesses immer stärker angewachsen ist, weil neue Quelleneditionen und Regestenwerke analog oder digital veröffentlicht wurden. Weitere von Fritz angeführte Gründe sind das große, herrschaftlich stark zersplitterte Untersuchungsgebiet, der lange Untersuchungszeitraum (8. bis 16. Jahrhundert) und die vielfältigen Arten von Mahl- und Spezialmühlen. Die grundlegenden Gesichtspunkte rund um das Thema Mühle, so scheint es dem Rezenten jedoch, dürften in der Untersuchung von Gerhard Fritz vollständig versammelt sein. Mit seinem Werk hat er auf dem Sektor der Molinologie Maßstäbe gesetzt.
Ludger Syré
Views: 80
