Württembergische Katholiken im Konflikt mit katholischer Aufklärung und Staatskirchentum (1802/3–1848)
(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, Bd. 237). 610 Seiten. Thorbecke Verlag, Ostfildern 2025. Hardcover 58 €. ISBN 978-3-7995-9602-2
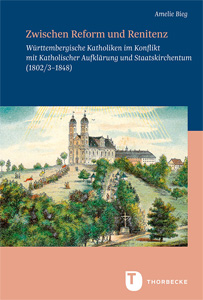
Deutlicher als es der Titel des Buches zum Ausdruck bringt, klärt die Einleitung den Nicht-Spezialisten darüber auf, um was es der Autorin geht, nämlich um die Frage, wie die katholischen Untertanen Neuwürttembergs damit zurechtkamen, dass sie – seit der napoleonischen Neuordnung Südwestdeutschlands im frühen 19. Jahrhundert – unter protestantischer Herrschaft im frisch geschaffenen Königreich Württemberg lebten. Zudem mussten die Katholiken zur Kenntnis nehmen, dass sie in dem neuen Staat – mit verdoppeltem Territorium und verdoppelter Einwohnerzahl – gegenüber den Protestanten in der Minderheit waren. Das führte fast notwendigerweise zu Konflikten, weshalb die Autorin im Rückgriff auf die Methoden der Historischen Konfliktforschung »cleavages« (Konfliktlinien) in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung rückt, einer von Prof. Sabine Holtz, Universität Stuttgart, betreuten Dissertation.
Unverzichtbar zum Verständnis des historischen Hintergrunds sind die Ausführungen Biegs im zweiten Kapitel. Darin geht es zum einen um die Errichtung der Diözese Rottenburg und der Oberrheinischen Kirchenprovinz im Zuge der Neuorganisation der Diözesen nach der Zerschlagung der Reichskirche durch die Säkularisation, zum anderen um das Phänomen der Katholischen Aufklärung, welche auch als »Reformkatholizismus« bezeichnet wird. Der um 1730 einsetzende, um 1850 auslaufende Reformprozess ist u.a. eng mit dem Namen des Konstanzer Generalvikars und Bistumsverwesers Ignaz Heinrich von Wessenberg verbunden, der entweder im Erzbistum Freiburg oder im Bistum Rottenburg gerne Bischof geworden wäre, aber vom Papst strikt abgelehnt wurde. Aus den nicht nur von ihm vertretenen Vorstellungen eines rationalen Christentums und eines vernunftbasierten Christenmenschen resultierte eine Reform von Liturgie und religiöser Praxis, die im Widerspruch stand zu der vom Barockkatholizismus geprägten katholischen Lebenswelt und die zur Kritik an den tradierten Frömmigkeitsformen oder am bestehenden Wallfahrtswesen führte. Als dritter grundlegender Aspekt wird in diesem Kapitel das württembergische Staatskirchentum beschrieben: Da der württembergische Staat Schutz- und Aufsichtsrechte gegenüber der Katholischen Kirche beanspruchte, schuf er sich mit dem Kirchenrat ein entsprechendes Aufsichtsorgan, das dem Ministerium unterstellt war und das man als Gegenspieler zum katholischen Bischof und Ordinariat ansehen darf. Auf eine Geschäftsordnung, die die Kompetenzen beider Seiten gegeneinander abgegrenzt hätte, hat man sich nie verständigen können.
In den folgenden Kapiteln werden die Konfliktfelder detailliert ausgebreitet, um zu zeigen, dass und wie die Katholiken im Königreich Württemberg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter doppelten Druck gerieten: im Inneren unter den des Reformkatholizismus und im Äußeren unter den des Staatskirchentums. Bei der Suche nach den Konfliktlinien beansprucht die Autorin, eine gesamtwürttembergische Perspektive einzunehmen, um Parallelen und Unterschiede zwischen den verschiedenen katholisch dominierten Regionen herauszuarbeiten. Zu diesen Gebieten zählten Oberschwaben, die Gegend um Rottweil und Spaichingen, die Ostalb sowie Tauberfranken um Mergentheim. Die genannten Gebiete hatten vor der Säkularisation verschiedenen Bistümern angehört.
Wo taten sich Konfliktlinien auf? In Kapitel III, in dem es um bikonfessionelle Gegenden geht, werden diese dargestellt am Beispiel von Jubiläumsfeiern und von Feiertagsregelungen sowie von konfessionellen Auseinandersetzungen in bestimmten Städten. In Kapitel IV stehen die Gottesdienstordnungen im Mittelpunkt der Betrachtung, zum einen die Konstanzer Gottesdienstordnung von 1809, zum anderen die allgemeine Gottesdienstordnung für Württemberg von 1837/38. Dann folgt in Kapitel V der Blick auf die religiöse Praxis, die für den einzelnen katholischen Untertanen vermutlich die größte Relevanz unter allen strittigen Fragen hatte. Die hier behandelten Streitthemen im Kontext der Frömmigkeitsausübung kreisen um die Feiertage, die Oster- und Weihnachtsbräuche, den Kirchengesang und schließen auch eher kuriose Angelegenheiten ein wie das Verbot angekleideter [sic!] Marienfiguren. Ein zweiter Komplex sind die Wallfahrten zu Orten im Inland und im Ausland, die den Vertretern der Katholischen Aufklärung ebenso wenig passten wie den Protestanten und den Repräsentanten der Staatskirche. Das Zwischenfazit Biegs spricht hier für sich: Die Gläubigen hätten die Katholische Aufklärung wohl als eine »Aneinanderreihung nahezu endloser Verbote« erlebt. Schließlich ist noch Kapitel VI zu nennen, in dem es um politische Wahlentscheidungen geht: Wem sollten Katholiken bei Landtagswahlen ihre Stimme geben? Kandidaturen in verschiedenen oberschwäbischen Oberämtern boten sich hier zur exemplarischen Behandlung an.
Dass die Autorin für ihre Untersuchung auf einen ungemein reichen Fundus an Quellen in staatlichen und kirchlichen Archiven zurückgreifen konnte, spiegelt die facetten- und detailreiche Darstellung eindrucksvoll wider. Ihre Frage, wie die Katholiken, die zuvor Jahrhunderte lang in katholisch geprägten Territorien gelebt hatten, reagierten, als sie zu Untertanen Württembergs wurden und damit unter protestantische Herrschaft gerieten und dadurch ihr gewohntes religiöses Leben in Frage gestellt sahen, dürfte auch den historisch bzw. kirchengeschichtlich ambitionierten Laien in hohem Maße fesseln. Ob er sich deswegen durch 600 Seiten lesen wird, darf freilich bezweifelt werden. Gewiss zählt er aber auch nicht zu der primären Zielgruppe der außerordentlich verdienstvollen Studie von Amelie Bieg.
Ludger Syré
Views: 12
